Die Persönlichkeitsrechte im Buch sind vor allem dann wichtig, wenn du reale Personen in deinem Buch erwähnst oder gar über sie schreibst. Das kann dich schnell in Teufels Küche bringen. Wir bringen ein wenig Klarheit in das Thema der Persönlichkeitsrechte und erklären dir, was erlaubt ist und was nicht.
Das Persönlichkeitsrecht und die Kunstfreiheit
„Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, sang vor einigen Jahren eine Antilope. Ganz so einfach ist das aber nicht. Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrecht stehen sich auf gewisse Weise gegenseitig im Weg. Oder besser gesagt: Das Persönlichkeitsrecht steht in der Regel über der Kunstfreiheit.
Die Persönlichkeitsrechte umfassen diese Rechte:
- Recht am eigenen Bild
- Persönliche Daten
- Vertraulichkeit von Gesprächen
- Intimsphäre
- Persönliche Ehre
Das bedeutet, du darfst nicht einfach …
- das Bild einer Person verwenden oder diese im Text beschreiben
- Daten einer Person preisgeben
- Zitate und Gespräche wiedergeben (hier greift zudem auch das Zitatrecht)
- die Intimsphäre einer Person verletzen
- jemanden beleidigen oder durch falsche Tatsachen verleumden
Wie du dir denken kannst, ist die Definition, wann manche dieser Faktoren erfüllt sind, nicht eindeutig geklärt. Deshalb entscheidet im Einzelfall das Gericht (sollte es zu einer Klage kommen). Als Präzedenzfall in Deutschland gilt die Mephisto-Entscheidung vom 24. Februar 1971.
Damals entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Kunstfreiheit nicht als Vorsatz verwendet werden kann, um Persönlichkeitsrechte auszuhebeln. Bei einer Kollision der Kunstfreiheit mit anderen Gesetzen und Rechten muss deshalb immer eine Abwägung der Rechtsgüter vorgenommen werden.
Der damals behandelte Fall handelte übrigens von einem fiktiven Roman, der sich aber wahrer Tatsachen bediente. Das führt uns dann auch tiefer ins Thema rein.
Kann ich das Persönlichkeitsrecht trotz realer Erzählung umgehen?
Kurze Antwort: nein.
Im erwähnten Mephisto-Urteil beispielsweise war es so, dass der Protagonist des Romans namens Hendrik Höfgen seinen Aufstieg als Schauspieler bewerkstelligt, indem er einen Pakt mit den Nationalsozialisten eingeht. Viele Einzelheiten des Romans erinnerten sehr stark an die wahre Geschichte des Schauspielers Gustaf Gründgens, der einst von Hermann Göring stark gefördert wurde.
Der Roman erschien 1936. Gründgens starb 1963. 1965 legte der Adoptivsohn und alleinige Erbe Gründgens Klage gegen die Nymphenburger Verlagshandlung ein, die den Roman vertrieb. Wie wir wissen mit Erfolg.
Es ist also weder ein Freifahrtschein, wenn eine Person bereits verstorben ist, noch wenn man Namen und gewisse Fakten ändert. Ist eine reale Person noch klar in der Figur zu erkennen, ist das eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts.
Ein weiterer – modernerer – Fall untersagte einem Autor die Veröffentlichung seines Buchs, weil er darin aus der Ich-Perspektive über seine Ex-Freundin und deren gemeinsames Privatleben berichtete. Dadurch war die Freundin klar erkennbar und die Schilderungen zu nah an der Realität, um rein als Kunst zu gelten und so von der Kunstfreiheit gedeckt zu sein.
So greift Kunstfreiheit vor Persönlichkeitsrecht
Wo im Einzelfall entschieden wird, gibt es natürlich auch Beispiele, in denen zugunsten der Kunstfreiheit entschieden wurde. Beispielsweise vom Landgericht Hamburg in einem Fall, in dem ein Galeristenpaar in einem Roman erkennbar war.
Das Gericht entschied aufgrund von zwei Faktoren zugunsten des Autors:
- Die Intimsphäre des Paars wurde nicht verletzt, da die Schilderungen nicht in den privaten Bereich gingen.
- Die Darstellung der Ereignisse fand nicht in einem faktengetreuen Rahmen statt, sondern wirkten ausreichend künstlerisch verformt.
Dabei handelt es sich um die sogenannte Sozialadäquanz, bei der die Kunstfreiheit vor das Persönlichkeitsrecht gestellt wird.
Daraus ergibt sich, dass du bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen kannst, um so weit wie möglich weg vom Persönlichkeitsrecht hin zur Kunstfreiheit zu gelangen.
- Nutze nicht die echten Namen, Orte und beschreibe nicht genau identifizierbar.
- Erzähle in einer distanzierten Perspektive statt aus der Ich-Perspektive.
- Hol dir die Einwilligung der Personen ein, die du erwähnen möchtest.
Letzter Punkt ist natürlich einfacher zu bewerkstelligen, wenn du positiv über die Person berichtest.
Grundsätzlich gilt ohne Einverständnis immer, dass die Gefahr auf eine Klage besteht. Auch wenn diese zu deinen Gunsten ausgeht, ist das natürlich stressig.
Strafen bei Verletzung der Persönlichkeitsrechte
Sollte es zu einer Klage wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten kommen, ist das grundsätzlich nicht gut. Zum einen hast du dadurch Stress, den du lieber vermeiden willst, und zum anderen kann es deinem Buch generell schaden. Nicht jede Publicity ist gute Publicity.
Wenn du den Fall verlierst, dann natürlich erst recht. Ziemlich sicher ist, dass du dann dein Buch vom Markt nehmen müsstest. Natürlich könntest du es in geänderter Form neu veröffentlichen, aber der Aufwand von Zeit und Geld ist nicht zu unterschätzen.
Apropos Geld: Die Gerichtskosten trägst du. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Schadenersatz gefordert wird. Vielleicht auch zusätzlich eine öffentliche Berichtigung und Gegendarstellung.
Eher unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich – ist in schweren Fällen sogar eine Freiheitsstrafe.
Im besten Fall sicherst du dich also im Vorfeld ab oder verzichtest möglichst auf die Einbindung realer Personen. Dann kann sich auch niemand beschweren.
Disclaimer: Wir sind keine Anwälte und können entsprechend keine Rechtsberatung ersetzen. Alle hier getätigten Aussagen basieren auf unserer Recherche, aber wir geben keine Garantie auf Korrektheit.

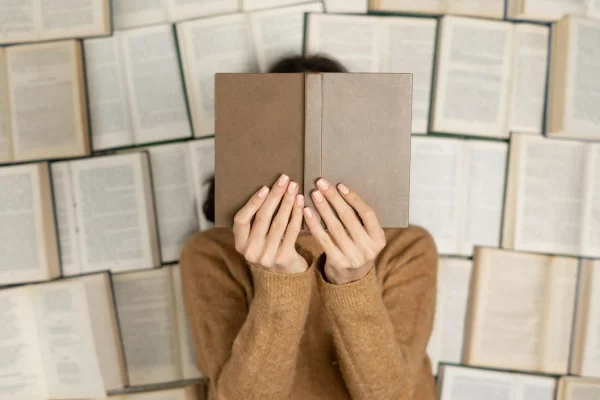
Hervorragend! Der Artikel ist wirklich eine Kunst am Seil. Er zeigt, dass zwischen der Kunstfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht eine heikle Balance zu finden ist – fast so knifflig wie beim Mephisto-Fall selbst. Man lernt wirklich, dass man bei realen Personen besser vorsichtig sein sollte, besonders wenn man keine Einwilligung hat. Die Tipps mit dem Ändern von Namen und der distanzierten Perspektive klingen fast so, als würde man ein Roman sozialadäquat verpacken, als würde man eine Zwiebel schälen. Am witzigsten finde ich vielleicht die Andeutung, dass man auch Geld für Gerichtskosten und möglichen Schadenersatz aufbringen muss – das ist ja wirklich ein großer Aufwand, wenn man nur eine gute Geschichte erzählen will. Aber hey, wer sagt, dass Kunst immer einfach sein muss?