Als die Mittzwanzigerin Hennie versucht, ein Familienrätsel zu lösen, ist ihr nicht bewusst, dass es eigentlich ihre Fragen sind, die sie ans Leben stellt und auf die sie Antworten erhofft.
Das Flüstern der Pappeln
„Ich erwarte nichts von Dir. Das habe ich nie.“
Es ist wie ein Flüstern, welches ich vernehme. Wie ein Rascheln von Papier. Als ob ich jeden einzelnen der Briefe hier dem Land entnehme. Sie unter den Bäumen aufspüre, aus der Erde grabe. Und sie dann in meinen Händen entfalte.
Es fühlt sich an wie ein Hauch, der mich streift. Ein Atemzug. Ein Streicheln, welches mich liebkost. Und trotzdem bin ich achtsam, ich muss es sein.
Es ist wie der Wind, der durch die Pappeln streift. Nur er kann ihnen ihr Lied entlocken. Diese Töne, die einmalig sind. Nie habe ich etwas Vergleichbares vernommen.
Und würde ich dieses Lied komponieren, so würde ich ihm einen anderen Text zufügen. In meinem Lied würde ich von dem Mädchen erzählen, welches nach Hause zurückgekehrt ist und diese Briefe findet, unter den Pappeln.
Doch so ist es nicht.
Es ist das Lied des Windes. Und jetzt, da ich unter den Bäumen wandle, und er mir durchs Haar streift, ist es auch meines. Ich habe es zu meinem gemacht.
Und der Text ist nicht stimmig. Ich habe ihn verändert.
Ich finde sie, die Briefe, ja. Eher noch fanden sie zu mir. Doch ich hole sie nicht hervor, von tief unter der Erde.
In Wirklichkeit ist es ein ganz nüchterner Prozess. Das ist die Wirklichkeit immer. Nüchtern.
Ich hole die Briefe aus einem Postfach. Und ich weiß, dass sie nicht an mich gerichtet sind, ich wusste es von Anfang an, seit ich die ersten Zeilen gelesen hatte. Doch das spielt keine Rolle.
Und vielleicht will ich sie ja auch nicht hergeben. Ich will sie für mich. Denn sie entreißen der Wirklichkeit ihre starre Maske aus Nüchternheit und Logik. Sie entblößen der Welt wahres Gesicht. Wenn auch nur für einen kurzen Augenblick.
Ich gehe unter den Pappeln entlang, diesen hohen, majestätischen Bäumen. Hoch und schlank sind sie, und doch voller Demut. Wie der Milan, der über die Ebenen hier streift. Auch er verneigt sich vor der Welt und der Schönheit, mit der sie gesegnet ist.
Es ist diese Schönheit, vor der ich geflüchtet bin. Die Leute im Ort sagen: „Sieh dir die Hennie an, sie ist klug und geht hinaus. Sie fährt nach Übersee, um Mediendesign zu studieren. Sieh sie dir an!“ Die Wahrheit erzählt eine andere Geschichte, und auch dieses Mal ist sie nüchtern, während sie das tut.
Ich hatte Angst.
Ich bin geflohen vor dieser Schönheit, vor dieser unwiderruflichen Schönheit, die einfach und unbedingt ist und immer da. Sie verlangt einem nichts ab. Genau wie die Liebe meiner Eltern.
Diese Liebe kann einem himmelangst werden lassen. Sie liegt wie eine tonnenschwere Kette zwischen Mama und Papa und verlangt nichts. Manchmal stolpert man darüber.
Meistens bin ich das. Ich tue es noch immer, doch in dem Jahr, als ich mich entschied, den elterlichen Hof zu verlassen, tat ich es beinahe jeden Tag.
„Hennie!“ Dieser Schrei fährt einem in die Knochen.
Ich bin ganz allein auf dem Grundstück, zumindest was den Geist angeht. Mama ist körperlich anwesend, doch sie arbeitet in der Werkstatt, und dort sind ihre Sinne ausschließlich auf das Glas ausgerichtet.
Und Großmutter ist dem Tod näher als dem Leben, ihr Geist schwebt daher frei umher und ist nicht als anwesend zu bezeichnen.
Ich kneife die Augen zusammen und blicke auf die Kirchturmuhr, die jedoch viel zu weit entfernt ist. Der Pappelhof liegt verlassen. Die Nachbargrundstücke sind mit bloßem Auge zu erkennen, ebenso der Ortskern; Einsamkeit ist dennoch das richtige Wort.
Ich sehne mich nach der Einsamkeit. Ich hätte sie gern aufgesucht, im Norden der USA. Wyoming, das war mein Sehnsuchtsort. Das ist er noch immer. Vielleicht kriegt man so einen Sehnsuchtsort nicht mehr los, wenn man ihn einmal gefunden hat. Wenn man ihn einmal in sein Herz gelassen hat. Womöglich ist man ihm für immer ausgesetzt, für immer in ihm verloren.
Mir gefällt das, obwohl ich normalerweise mit für immer nicht viel anfangen kann.
Großmutter ersetzt die Kirchturmuhr. Das schafft ihr Geist noch. Oder vielleicht ist er rüber in den Ort geflogen und hat einen Blick auf die Spitze des Kirchturms geworfen.
Das erste, was ich getan habe, als ich an den Hof zurückkehrte, war, meine Uhr abzustreifen. In New York braucht man ständig eine Uhr, man ist so abhängig von der Zeit, dass sonst nicht mehr viel von einem übrigbleibt.
Nun liegt sie in der Kommode neben meinem Bett, dieses hässliche Swarovski Ding, und ich habe nicht vor, es je wieder anzulegen.
Ich lasse die Pappeln hinter mir, und sie schweigen. Ich wünschte, es würde ein Wind aufkommen und sie ihre Geschichte erzählen lassen.
Der Hof ist ein riesiges Karree, auf der Seite zur Straße die breite Einfahrt und das Tor, links daneben das Wohnhaus, dahinter die Werkstatt.
Ich steuere auf das Haus zu, und der Kies knirscht unter meinen Füßen. Ich weiß, dass Mama bis zum Abend in der Werkstatt beschäftigt sein wird. Papa ist draußen auf den Feldern. Ich schätze, dass er bereits mäht. Es war trocken die letzten Tage.
Im Haus hat sich nichts verändert. Nur der Geruch stört mich. Es riecht nach Krankenhaus. Vermutlich hat sich dieser Beigeschmack ins Haus geschlichen, als Großmutter aus der Klinik wiederkam.
Der Geruch stört mich, weil er sich über diesen herben Duft von Holz und Gras legt, und ich Angst habe, dass er ihm den Atem nimmt. Über kurz oder lang wird das geschehen.
Wie lang, das vermag niemand zu sagen. Keiner wagt eine Prognose darüber, wann Großmutter sterben wird. Und alle wissen, dass es bald sein sollte.
Ich bin nicht die Einzige, die so denkt, doch ich bin die Einzige, die es ausspricht. Alle haben sich entsetzt angeblickt. Die sollen nicht so tun, diese Heuchler.
Ich gehe die mächtige Treppe nach oben. Ein langer Flur führt durch das Geschoss zum Zimmer mit dem Krankenbett. Pflegebett heißt es. Was hat das mit Pflege zu tun, frage ich mich. Es ist eher ein Sterbebett.
Oder ein Übergangsbett, wenn das Totenbett der Sarg ist. Oder der Platz unter der Erde.
Ich möchte einmal unter den Pappeln liegen.
Der Flur zieht sich beinahe endlos, und ich nehme an, dass es im Winter ziemlich schaurig ist, ihn entlangzugehen. Allein das Ziel dieses Ganges ist schaurig. Im Winter ist es duster und still, man hört Dinge, die man sonst nicht hört in diesem riesigen Haus.
Doch jetzt, im Frühsommer, ist es hell, alle Fenster sind geöffnet, und neben Desinfektionsmitteln und Exkrementen riecht es nach Erde. Vielleicht passt das auch zusammen.
Ich besuche Hedi jeden Tag um dieselbe Uhrzeit. Ein Uhr mittags. Heute war ich mit dem Essen später dran, doch Hedi hat meine Abwesenheit bemerkt und nach mir geschrien. Das ist äußerst selten. Und dass sie überhaupt etwas mitbekommt, ebenfalls. Nur wenn ich ihr von den Briefen erzähle, dann scheint sie hellwach.
Ich halte die Luft an, als ich vor ihrem Zimmer stehe, dann drücke ich die Klinke herunter.
„Guten Tag, Oma. Wie ist das Befinden?“
Es ist schlecht. Scheiße ist es. Und als würde das Schicksal auf einem unbestreitbaren Indiz beharren, klebt die Scheiße überall an Hedis Körper. Ich habe keine Ahnung, wie sie das anstellt, doch ich weigere mich, das sauber zu machen. Meine Eltern haben entschieden, sie nach Hause zu holen, also sollen sie auch den Dreck wegmachen.
„Der Tod macht Dreck, was, Hedi?“ Ich setze mich in den Korbsessel zu ihrer Rechten, so habe ich den Blick auf die Pappeln.
Die Großmutter nickt mit aufgerissenen Augen. Ich nenne das den Blick der Wahrheit. So schaut sie immer, wenn sie denkt, dass ich etwas Gutes gesagt habe. Und ich freue mich darüber. Ich habe die Sprache vermisst. Die Formen, die sie annehmen kann; die Gebilde, die man aus Worten entstehen lassen kann.
„Ich putze das nicht weg, das weißt du. Warten wir auf den Pflegedienst.“
Sie tut nichts. Meine Großmutter ist die Einzige, die meine Einstellung zu akzeptieren scheint.
Ich blicke in ihre Augen aus Wasser. Sie sehen aus wie winzige Seen in einer runzeligen Berglandschaft. Manchmal habe ich Angst, dass sie zerfallen. Einen besseren Begriff habe ich für das Wasser noch nicht gefunden.
Wenn ich zuviel von dem Anblick meiner Großmutter habe, blicke ich aus dem Fenster auf die Pappeln.
Hedi sieht komisch aus, wie breitgelaufen. Flach und breit, als habe sie vor, die gesamte Fläche des Bettes auszufüllen.
Jetzt bewegt sie ruckartig die Hand, es ist immer der Zeigefinger, und die anderen Finger folgen. Es sieht aus, als würde sie dirigieren. Eine zuckende Melodie. Eine Arie in Ekstase.
Ich ziehe den Brief aus meiner Tasche und lese ihn ihr vor. „Ich erwarte nichts von dir. Das habe ich nie.“
Wir lauschen den Worten und warten, wie sie nachhallen. Das tun sie immer. Und auch wir beide tun immer dasselbe, meine Großmutter und ich. Wir sitzen da und lauschen und warten. Warten darauf, was die Worte mit uns anstellen werden.
Ganz am Anfang konnte ich das nicht. Es tat einfach zu sehr weh. Die ersten Briefe waren wortreicher. Das war schmerzhaft. Die Worte waren wie eine Spitzhacke, die sich zu den tiefsten Reichen der Seele durchgräbt. Und dort alles freilegt.
Natürlich wollte ich das nicht, ich will es noch immer nicht. Ich weigere mich, etwas freizulegen.
Doch die Neugier ist mächtig. Sie verdeckt den Schmerz. Und der Schmerz ist ja nicht meiner, er gehört meiner Großmutter.
Und während die Spitzhacke weiter gräbt und ihre tiefsten Kerne freilegt und sie in Seelenpein verwandelt; liegt sie in ihrer Scheiße und wartet auf den Tod.
Der Brief, den ich in den Händen halte, ist der achte. Ich habe ihn Hedi bereits gestern vorgelesen, und den Tag davor. Vorgestern habe ich ihn aus der Stadt geholt, und gleich nach dem Essen bin ich die Stufen hochgestiegen zu Hedis Zimmer.
Ich kann lediglich einmal in der Woche in die Stadt fahren, höchstens. Es gibt nur ein Auto auf dem Hof, und Mama und Papa wollen wissen, was ich zu tun habe, was ich brauche.
Ständig müssen sie alles wissen über mich. Mir ist klar, dass sie sich fragen, warum ich wieder da bin, das fragt sich jeder, einschließlich mir. Und über das Gerede im Ort will ich gar nicht nachdenken.
Natürlich brauche ich nichts aus der Stadt. Auf dem Hof gibt es Lebensmittel und WLan. Das ist alles, was ich benötige.
Doch jetzt sind da diese Briefe, die etwa einmal pro Woche kommen, sie werden an ein Postfach geschickt, von wo ich sie abhole. Als die Benachrichtigung kam, war ich, wie so oft, alleine auf dem Hof. Es waren ein kleiner Schlüssel und die Nummer des Postschließfaches, adressiert an H. Steumann. Die Adresse war korrekt, also dachte ich, es sei an mich gerichtet. Ich erwartete noch einige Schreiben aus New York und London, und meine Großmutter konnte ja wohl kaum gemeint sein. Also fuhr ich in die Stadt und holte den Brief ab.
„Was meinst du, Hedi?“, frage ich. Das tue ich oft. Dann sieht sie irgendwo hin, zur Decke, oder aus dem Fenster, wenn sie es schafft, den Kopf zu drehen.
Ich erwarte nichts von dir. Das habe ich nie.
Welch Aussage.
Ich stehe auf und gehe zum Fenster. Ich tue es langsam, damit meine Großmutter meinen Schritten folgen kann. Ihre Augen sind schnell, die letzten Beine des Geistes, doch ihre Halswirbelsäule ist fest, und die Automatik gestört.
„Weißt du, wer auch nichts erwartet?“, frage ich, bevor ich mich zu ihr umdrehe. Der Geruch von Urin und anderen Dingen kommt mir wie ein Schwall entgegen. „Der Tod.“
Hedi nickt mit dem Blick der Wahrheit.
„Der Sensenmann. Der Übersetzer. Der Fährmann. So hast du ihn immer genannt, weißt du noch?“
Sie schließt die Augen, ein müdes Nicken.
„Du hast oft von ihm erzählt, Hedi. Wie er übersetzt aus einem Boot, mit einer schaukelnden Laterne. Manchmal war es eine gebogene Baumwurzel, in der er stand, der Fährmann. Weißt du das noch, Hedi?“
Ein Nicken mit den Augen.
„Das war schön. Es waren schöne Geschichten. Immer habe ich ihn vor mir gesehen, wie er da stand in der Baumwurzel. Und drüben …“ Ich deute aus dem Fenster Richtung Norden, „drüben im Sumpfgebiet habe ich mir immer eingebildet, ihn zu sehen. Ich meine, wirklich zu sehen. Wahrhaftig. Im Moor.“
Meine Großmutter schließt die Augen, und ich weiß, dass sie in diesem Moment das Moor vor sich sieht, genauso wie ich.
„Ich habe mich immer gefragt, wie groß diese Wurzel sein muss, um genug Platz zu bieten für den Sensenmann und seinen Gast. Ist das der richtige Ausdruck, Hedi?“
Sie macht die Augen auf und sieht mich an. Ein Nein.
„Dann muss ich wohl nach einem richtigen Ausdruck suchen“, sage ich. Und dann trete ich näher ans das Bett heran, in dem sie liegt, flach wie ein Tuch.
„Und du musst mir sagen, wer dieser Mann war, Großmutter. Warum du ihm Briefe geschrieben hast, und warum sie jetzt zurückkommen. Jede Woche einer.“ Ich sage es eindringlich, und Hedi schließt die Augen, und eine Träne sammelt sich in dem Gebirge aus Hautfalten.
Ich habe sie erschöpft. Missmut beschleicht mich. Ich weiß, dass sie dem Rätsel genauso auf der Spur ist wie ich. Sie kann sich nicht erinnern. Oder sie will, dass ich es löse. Es ist ihre letzte Aufgabe für mich.
„Okay“, sage ich. „Das war zuviel. Es tut mir leid. Mach ein Nickerchen, bevor der Pflegedienst kommt.“
Sie hat noch immer die Augen geschlossen, als ich das Zimmer verlasse.
Das Mädchen, welches die Briefe fand, die eigentlich an jemand anderes gerichtet waren, bin ich. Es ist ein trauriges Lied, das ich zusammen mit den Pappeln singe.
Und doch ist es schön.
Meine Großmutter ist ihrem Mann untreu gewesen. Ich verurteile das nicht. Ich halte im Grunde nicht sehr viel von der Liebe. Vielleicht, weil sie und ich uns noch nicht begegnet sind. Ich habe Angst vor den Ketten, die sie wirft.
Und vielleicht habe ich auch deswegen Angst vor den Briefen. Weil sie an diesem Grundsatz rütteln. Nur wer mit solchen Worten sprechen kann, dem ist etwas Besonderes widerfahren. Und das ist die Liebe?
Ich muss es zumindest in Betracht ziehen. Noch nie habe ich solche Leidenschaft in Worten gespürt. Ich kann sie beinahe schmecken. Nur wer so leidenschaftlich liebt und leidet, der lebt.
Mehr zu Julia

Blog: juliaschreibt.wordpress.com
Twitter: @JuliaInNathen
Zum Buch: Amazon
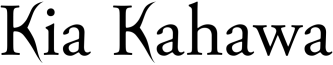


0 Kommentare